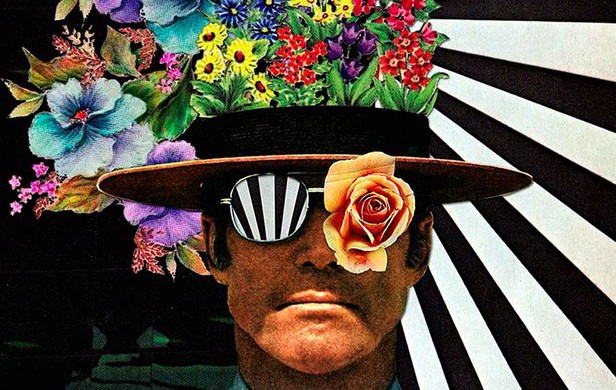© Eugenia Loli – Room With An Almost View
Irrtümer und Halbwissen II
Stefan Dewald (SD)
Jens Müller (JM)
Philine Edbauer (PE)
Frank Sembowski (FS)
17. Dezember 2016 (bearbeitet am 16. September 2017)
Aufgrund ihrer Gefährlichkeit sollten psychoaktive Substanzen nicht wie Genussmittel vertrieben werden.
Bedauerlicherweise werden Alkohol und Tabak wie Genussmittel vertrieben. Es entspricht in keiner Weise unserer Intention, psychoaktive Substanzen frei verfügbar zu machen. Wir fordern ohne Ausnahme den regulierten Verkauf und lehnen Werbung in jeglicher Form ab.
(SD, JM, FS)
Alkohol und Tabak sind erlaubt, weil wir gelernt haben mit ihnen umzugehen.
Die mit Abstand häufigsten Probleme verursachen in unserer Gesellschaft die legalen Substanzen Alkohol und Tabak. Im Jahr 2012 waren 1,8 Millionen Personen alkohol- und 5,6 Millionen Menschen tabaksüchtig; weitere 1,6 Millionen Alkoholkonsumenten zeigten im selben Zeitraum ein gesundheitsschädigendes Verhalten. Der hohe Verbreitungsgrad eines Stoffes ist kein Beleg für seine Harmlosigkeit. Alkohol ist zentraler Bestandteil vieler Traditionen, Feste und Rituale. Sie führen auf unverantwortliche Weise Jugendliche und Heranwachsende an den regelmäßigen, unreflektierten Konsum heran.
(FS)
- Pabst, Alexander; Kraus, Ludwig; Matos, Elena Gomes de; et al. (2013): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012. Sucht. 59 (6): pp. 321–331.
- Institut für Therapieforschung (IFT) (2012): Kurzbericht: Epidemiologischer Suchtsurvey 2012. Prävalenz des Alkoholkonsums, episodischen Rauschtrinkens und alkoholbezogener Störungen nach Geschlecht und Alter im Jahr 2012.
Cannabis, Opium und andere Drogen sind unserer Kultur fremd.
Das ist ein weitverbreiteter Irrtum: Schlafmohn, aus dessen unreifer Fruchtkapsel Rohopium gewonnen wird, stammt aus Europa. Der Ursprung von Cannabis sativa liegt entweder in Mitteleuropa oder in Zentralasien. Beides sind uralte europäische Kulturpflanzen, die schon für das Neolithikum in Europa nachgewiesen werden konnten. Fremdheit sollte außerdem kein Argument dafür sein, etwas abzulehnen. Ein Großteil unseres Speiseplans besteht aus Pflanzen, die aus allen Teilen der Welt stammen. Viele Technologien, ohne die wir uns ein Leben nicht mehr vorstellen können (wie zum Beispiel Smartphones), sind erst wenige Jahre auf dem Markt.
(PE, SD, JM, FS)
Der Staat hat die Pflicht, seine Bürger zu schützen.
Die gesetzliche Einteilung der Substanzen in die Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Der generalpräventive Ansatz, der Grundrechte einschränkt und alle Bürger zu Objekten einer Zielsetzung macht, beraubt sie ihrer Menschenwürde und ist in dieser Gestalt – kurz gesagt – verfassungswidrig.
(FS)
- Böllinger, Lorenz (2015): Das Scheitern strafrechtlicher Drogenprohibition: Zur Notwendigkeit einer Reform des Drogenstrafrechts. Humboldt Forum Recht (HFR).
Wollen wir ein Volk der Kiffer und Junkies werden?
Wer legt fest, wie die vorbildliche Gesellschaft auszusehen hat? Das Grundgesetz kennt jedenfalls kein spezifisches Konzept des guten und angemessenen Lebens. Ausdrücke wie Kiffer oder Junkie sind ideologisch gefärbt und tragen lediglich dazu bei, den Lebensstil einer Person und ihr persönliches Schicksal zu verunglimpfen, sie auszugrenzen und zu stigmatisieren. Es ist zudem nicht belegbar, dass Rauschmittel die Wirtschaftsleistung eines Landes negativ beeinflussen und der Gesellschaft Schaden zufügen. Aktuelle Daten weisen darauf hin, dass der Legalitätsstatus die Höhe des Konsums nicht wesentlich beeinflusst, wo nicht sogar verringert.
(PE, FS)
Was ist mit den Drogentoten?
Aus humanistischer Sicht sollte nicht erst der Tod eines Menschen dazu Anlass geben, eine Situation zu überdenken und zu verbessern. Davon abgesehen ist nicht zu erwarten, dass die Anzahl der substanzinduzierten Todesfälle ansteigt. Beispielsweise wurde in Portugal nach Einführung der Entkriminalisierung psychoaktiver Substanzen das Gegenteil beobachtet. Ein gewisser Prozentsatz der Todesfälle geht auf die illegalen Lebensumstände der Konsumenten zurück, das ist: auf Unterernährung, kontaminiertes Spritzbesteck, auf Verunreinigungen und falsche Dosierungen. Die Verringerung von Drogentoten mag imposant klingen und den konservativen Wählern schmeicheln; die komplexere Schadensverringerung in vielen Bereichen ist hingegen nicht so leicht in Zahlen ausdrückbar. Erstaunlicherweise wenden diejenigen, die das Argument der Drogentoten vorbringen, es nicht auf alkoholische Getränke und Zigaretten an. Die Statistiken stellen gerade diesen Rauschmitteln die denkbar schlechtesten Zeugnisse aus.
(PE, SD, FS)
Das würde uns Steuerzahler doch ein Vermögen kosten, für die ganzen Süchtigen aufzukommen.
Das tut der Steuerzahler bereits jetzt, und das, ohne durch die Besteuerung von Substanzen Einnahmen zu erzielen. Man sollte Sucht als gesellschaftliches Problem und als Ausdruck eines Mangels (nicht als Kostenfaktor) begreifen. Für die Behandlung einer unerwünschten Abhängigkeit wurde unser Krankenversicherungssystem schließlich geschaffen. Die Erforschung der Suchtursachen gepaart mit einer offenen und fundierten Aufklärung können die Suchtproblematik eindämmen und Kosten einsparen helfen.
(PE, SD, FS)
Wenn es so klar ist, warum wehrt sich die Regierung dagegen?
Die Gründe hierfür liegen in den historischen Entwicklungen. Das sogenannte Opiumgesetz sollte ursprünglich den internationalen Warenverkehr für Stoffe wie Morphin und Kokain regeln. Später nahmen protestantische Sekten die internationalen Konventionen zum Anlass, ihre glaubensbedingten Moralvorstellungen eines gottgefälligen, richtigen Lebens durchzusetzen, aber auch völkische Ideologien trugen weltweit zur Festigung der Verbote bei. Die Freigabe von Rauschmitteln würde heutzutage viele konservative Wähler erschrecken, die noch immer das realitätsferne Ideal einer drogenfreien Welt verwirklicht sehen wollen. In der politischen Opposition ist die Liberalisierung durchaus ein Thema. Die Linken, die Piratenpartei und die Partei der Humanisten, um die am deutlichsten sich für eine Änderung einsetzenden Parteien zu nennen, haben gegenüber der Liberalisierung eine differenzierte Meinung. Ihre Programme berücksichtigen humanistische Grundsätze auch in Bezug auf die Einnahme psychoaktiver Substanzen.
(PE, FS)
- Holzer, Tilmann (2007): Die Geburt der Drogenpolitik aus dem Geist der Rassenhygiene. Deutsche Drogenpolitik von 1933 bis 1972. Norderstedt: Books on Demand GmbH.